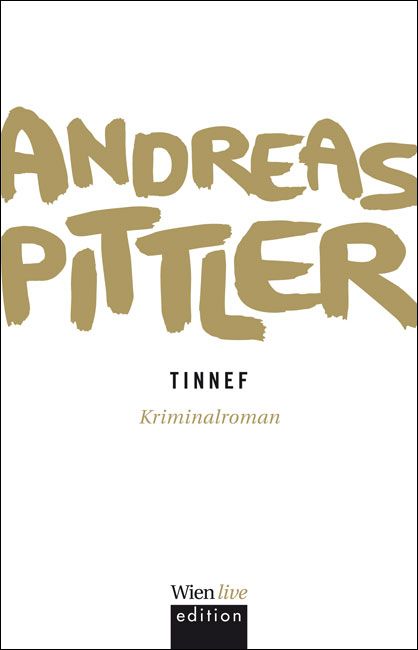Tinnef
Autor: Andreas Pittler
Verlag: echomedia Buchverlag
Umfang: 272 Seiten
Kurzinformation zum Buch
In einer Vorstadtwohnung hängt ein junger Generalstabsoffizier vom Kronleuchter. Der zuständige Polizist, David Bronstein, mag nicht so recht an einen Selbstmord glauben. Als er wenig später die Tochter eines Finanzbarons aus einer misslichen Lage befreit, nutzt dieser seine Verbindungen, um Bronstein einen Posten in der Mordkommission zuzuschanzen. Und das Fräulein Tochter findet Gefallen an dem jungen Kommissar. Bronsteins Ermittlungen bringen schon bald pikante Details ans Licht, die nicht allen Beteiligten genehm sind. Und auch seine neue Herzdame fühlt sich vernachlässigt. Muss Bronstein zwischen Pflicht und Liebe wählen? Wie wird seine Entscheidung ausfallen?
Mit „Tinnef“ legt Andreas Pittler den vierten Band seiner Kriminalsaga vor, mit der er die Geschichte Österreichs vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis zum Ende der Ersten Republik ebenso mitreißend wie spannend aufrollt.
Leseprobe aus »Tinnef«
Bronstein und Lang betraten das Innere der Wohnung und sahen schon von der Küche aus die Bescherung. Im Luster des Wohnzimmers hing ein Mann von knapp mehr als zwanzig Jahren. Er hatte einen dünnen blonden Schnurrbart, der mit dem Rotblau der herausgequollenen Zunge kontrastierte. Die wasserfarbenen Augen starrten schief an die Decke, und die Haare klebten an der Stirn, was darauf hindeutete, dass dem Mann doch ziemlich heiß gewesen sein musste, ehe er erkaltete.
„A natürlicher Tod war des jedenfalls keiner“, meldete sich Lang.
„Der Herr Leutnant hat ja immer Gspassetln g’macht, aber solche Spompanadeln, des is wos Neichs“, konstatierte derweilen die Frau, in der Bronstein die Hausmeisterin vermutete, emotionslos. Dass der Tote Offizier der kaiserlichen Armee gewesen war, erklärte die Uniform, die er trug. Und dass er sie anhatte, ließ einen Selbstmord zumindest in den Bereich des Möglichen rücken.
„Haben S’ was angefasst, Frau …“
„Kriwanek. Elfriede Kriwanek. I bin da die …“
„Hausmeisterin. Das habe ich mir schon gedacht. Und haben S’…?“
„Wos?“
„Na etwas angefasst.“
„Jo, bin i bled oder wos! Natürlich ned. Ich bin in die Wohnung, weil die alte Reininger, des is die Partei vom ersten Stock, direkt unter dera Wohnung, auf d’ Nocht an Pumperer g’hört hat. Und weil i den Herrn Leutnant heut ned g’sehen oder g’hört hab, hab i ma denkt, da is vielleicht a Unglück g’schehen. Und so bin i mit’m Generalschlüssel eine in die Wohnung.“
Die Frau hielt einen beeindruckend großen Schlüsselbund in die Höhe. „Na, und wie i eam do hängen g’sehen hab, da hab i alles g’wusst. Der is hin, hab i ma denkt. Da kannst nix mehr machen. Na, und so hab i den Wirten, der was als Einziger da a Telefon hat, g’sagt, er soll die Heh … die Polizei rufen. Na, und jetzt san S’ da.“
„Ja, jetzt simma da“, echote Bronstein und besah sich das Zimmer. Der Tisch, der sich direkt neben dem Gehenkten befand, war penibel aufgeräumt. Nichts, auch kein Schriftstück, lag darauf. Generell herrschte im Raum peinlichste Ordnung, nur ein Sessel lag umgestürzt auf dem Boden, was die These nahelegte, dass der Leutnant auf selbigen gestiegen war, ehe er sich die Schlinge um den Hals legte und den Sessel unter sich umwarf.
„Wissen wir, wie der Mann hieß?“, fragte er die Kriwanek.
„Des waaß i ned“, antwortete sie.
„Sie kennen die Namen Ihrer Parteien nicht?“, zeigte sich Bronstein überrascht.
„I scho. Aber danach haben S’ mi ja ned g’fragt. Sondern danach, ob Sie es wissen, und des wiederum waaß i ned.“
Schon wieder so ein vorwitziges Wiener Mädel, dachte Bronstein pikiert. Er setzte eine möglichst strenge Miene auf und sah die Kriwanek durchdringend an. Diese lenkte schließlich ein. „Mészáros hat er g’heißen. Aus Ungarn is er kommen. Aber er hat makellos Deutsch g’redet. Von der Mutterseiten her, glaub i. Und seit fünf Monat’ hat er da g’wohnt. Er is zum Generalstabskurs zug’lassen worden. Weil er irgendwas am Balkan z’sammbracht hat, wos i waaß.“ Die Hausmeisterin kratzte sich gedankenverloren am Kopf. „Na ja, jetzt wird er nix mehr z’sammbringen, der Kurtl.“
„Der Mann hieß Kurt?“ Bronstein war ehrlich erstaunt. Er hätte mit Lajos, Lászlo oder gar Árpád gerechnet, aber nicht mit Kurt. „Na, i sag Ihnen ja, sei Mutter dürft a Hiesige sein.“
Bronstein stutzte. Die Kriwanek war sicher an die fünfzig. Wieso duzte sie den Toten? „Und Sie waren per Du mit dem Herrn Mészáros?“
„Na, natürlich ned. Nur für uns, da war er der Kurtl. Wissen S’ eh, wenn ma über ihn g’redet haben.“
„G’redet?“ Bronstein ahnte, was die Frau meinte, aber so leicht wollte er es ihr dann doch nicht machen.
„Schauen S’, Herr Kommissar. Des is da ned des Ritz-Carlton, ned. Da wohnen nur Krewegerln, Krispindln und Krepierln. Was glauben S’, was da für ein Hallo is, wann amoi a echtes Mannsbild da einzieht?“ Auf dem Gesicht der Kriwanek zeigte sich ein seliges Lächeln. „Die Neziba von der Anserstieg’n, die Wejwoda und i, na ja, wir stengan hoit öfter amoi im Hof z’samm’, und da hamma natürlich übern Kurtl, also übern Herrn Leutnant g’redt. In unserm Alter, da derwischt so leicht kan Bel Ami mehr, verstehen S’?“
„Und wie war er so, der Herr Mészáros?“
„Stets sehr nett und zuvorkommend. A echter Herr halt. Und so bescheiden! Er hat uns immer Komplimente g’macht, wenn er uns im Hof z’sammenstehen hat sehen. Fesch, fesch, die Damen – oder so etwas. Dabei immer militärisch zackig, wissen S’ eh, aber doch sehr charmant.“
„Und wie war er so als Partei?“
„Ruhig. Sehr ruhig. Er hat fast nie Besuch g’habt. Außer hie und da jemand von seinem Regiment. Aber des waren, glaub i, mehr Besprechungen als a normale Abendgestaltung, wissen S’. Der war ned wie die anderen Offiziere, die was Karten spielen, saufen und herumhuren. Na, i glaub, der wollt was erreichen im Leben.“
Bronstein sah die Kriwanek nur lange schweigend an.
„Jo, i waaß eh, des klingt a bissl komisch, wenn ma den da so hängen sieht. Aber es muss ihm halt was passiert sein, was ihn aus der Bahn g’worfen hat.“
Ja, dachte Bronstein, diesen Satz konnte man getrost unterstreichen.
„Und Sie sagen“, fuhr er dann fort, „der Mann war beim Generalstab?“
„Na ja, bei diesem Kurs halt, wo man sich für den Generalstab … ich weiß ned, wie man da sagt … qualifiziert halt.“
Bronstein blies Luft aus. Das machte die Sache komplizierter. Mészáros musste nicht notwendigerweise dem „Korpsbereich 2“ zugehörig sein, der Wien umfasste, was Bronstein immer wieder zu der Frage trieb, weshalb ausgerechnet Krakau die Nummer 1 bekommen hatte. Er konnte als Ungar auch den Korpsbereichen 4, 5 oder 6 angehören, die um die Städte Pressburg, Budapest und Kaschau gruppiert waren. Die Rangabzeichen, die mit ihren zwei goldenen Sternen auf grünem Grund Mészáros als einen Oberleutnant auswiesen, sagten nichts über die Zugehörigkeit zu einer konkreten Truppe aus. Und Oberleutnant musste Mészáros auch gewesen sein, da man sich erst als solcher für den Generalstabskurs melden konnte, wie Bronstein sich dunkel erinnerte. Doch für die mehrjährige Ausbildungsphase war man dem Generalstab nur zugeteilt, man blieb Bestandteil seiner alten Truppe, und erst wenn man den Kurs erfolgreich absolviert hatte, konnte man auf Antrag des Generalstabs zu ebendiesem versetzt werden. Und das war bei Mészáros mit Sicherheit noch nicht der Fall gewesen, sonst hätte er bereits eine andere Uniform getragen. Und die Egalisierungsfarbe vermochte Bronstein auch keinen Aufschluss darüber zu geben, ob Mészáros in der österreichischen oder in der ungarischen Armee gedient hatte, denn diese unterschied zwar, wie er sich erinnerte, zwölf verschiedene Rottöne, doch galten diese jeweils für österreichische wie für ungarische Regimenter.
Es würde ihm also, seufzte er, nichts anderes übrig bleiben, als beim Generalstab nachzufragen, wohin Mészáros zuständig gewesen war. Bronstein holte seine Taschenuhr hervor und sah, dass es nahe an 15 Uhr ging. Wenn er beim Generalstab noch jemanden erreichen wollte, dann war es zweckmäßig, diesen zu verständigen. Allerdings war er ortsunkundig. Wer vermochte schon zu sagen, welche der hierortigen Stehweinhallen über ein Telefon verfügten. Aber immerhin befand sich gegenüber ein Bahnhof. Und auf einem Bahnhof musste es ein Postamt geben. Und auf einem Postamt konnte man telegraphieren. Er wandte sich der Kriwanek zu und bedankte sich für ihre Auskünfte, wobei er sie darum bat, sich sicherheitshalber die nächsten Tage zur Verfügung zu halten. Die Kriwanek fühlte sich geschmeichelt und lächelte servil. Doch Bronstein achtete nicht weiter darauf. Er drehte sich zu Lang um: „Du wartest hier, bis die Spurensicherung kommt. Ich telegraphiere einstweilen dem Generalstab, dass wir ihn brauchen.“
Bronstein wartete keine Reaktion der beiden Personen ab und verließ die Wohnung. Er ging die Stufen abwärts, durchquerte den Hof und steuerte die Straße an. Dort hielt er nach links auf das Postamt zu. Beim Portier angekommen, fragte er nach dem Telegrammschalter.
„Telewos?“
„Der Telegrammschalter“, wiederholte Bronstein eine Nuance klarer und lauter.
„So wos ham mia do ned.“
„Aber ich bitte Sie, das ist doch ein Postamt, oder etwa nicht?“
„Des scho. Oba a Telegramm, des gibt’s do ned.“
„Sie wollen mir ernsthaft erzählen, bei Ihnen kann man keine Depeschen aufgeben?“
„Ah so. A Depetschen! Wieso sogen S’ denn des ned glei? Des is do drüben!“
Bronstein sah in die gewiesene Richtung und erspähte tatsächlich einen Schalter, auf den bemerkenswerterweise in Balkenlettern „Telegramme“ gemalt war. Er verkniff sich eine ätzende Bemerkung in Richtung des Portiers und legte die paar Schritte zum besagten Schalter zurück. Dort schnappte er sich eines der ausliegenden Formulare und schrieb seinen Text darauf, freilich nicht ohne auch die anderen vorgeschriebenen Felder säuberlich auszufüllen. Dann beugte er sich zur Öffnung hinunter und linste in den Bereich, der den Postbeamten vorbehalten war.
„Tschuldigung“, nuschelte er durch die Öffnung, „i hättat do a Telegramm.“
Der diensthabende Postler warf einen geringschätzigen Blick in Bronsteins Richtung. Dann ergriff er eine neben ihm liegende Knackwurst und biss herzhaft hinein. Erst als seine Zähne vollends zur Ruhe gekommen waren, nahm er eine Bierflasche und tat einen langen, kräftigen Schluck. Endlich stand er auf und trat an den Schalter. Nach einer flüchtigen Musterung von Bronsteins Formular schob er dieses in Richtung des Polizisten.
„Wos soll i mit dem Wisch? Des is ja a Stadttelegramm. Des kann i ned annehmen.“
„Ah nicht? Ja, wer nachher dann?“
„Nur die Zentrale.“
„Aha. Und wo is die, die Zentrale?“
„Na auf der Hauptpost“, belferte der Postbeamte, sich über die Beschränktheit seines Visavis sichtlich wundernd. Dann schickte er hinterher: „Und übrigens, Auskunftsbüro bin i a kans.“
Der Mann hatte gesprochen, die Sache war erledigt. Er drehte sich um und setzte sich wieder an seinen Platz. Bier und Wurst waren wieder seine Klienten, und Bronstein war nur noch Luft.
Wenn er, so überlegte Bronstein, jetzt zur Hauptpost ging, um ein Telegramm abzuschicken, dann war es fraglos effizienter, sich unangekündigt sofort zum Generalstab zu begeben. Aber wo saß der überhaupt? Auf sein Telegramm-Formular hatte er wie selbstverständlich die Adresse des Kriegsministeriums geschrieben, doch das musste nicht notwendigerweise auch die Adresse des Generalstabs sein.
Egal, er war ja jetzt auf einer Post. Und da musste es doch wohl auch ein Telefon geben. Also beugte sich Bronstein ein weiteres Mal zu der Öffnung hinunter: „Wo kann man denn da telefonieren?“
Der Beamte sah nun wirklich zum Fürchten aus: „Sag, woll’n S’ mi frotzeln? I hab Ihnen schon g’sagt, dass i ka Auskunftei bin. Also schieben S’ ab, und des dalli.“
Nun kam aber auch in Bronstein die Wut hoch. Er hielt seine Kokarde durch den Schlitz und brüllte dann: „Jetzt reicht’s mir aber, du Safensiader. Wennst ned spurst, dann kastl i di ei für vierazwanz’g Stunden. Hast mi? Also jetzt sag mir g’fälligst, wo i da telefonieren kann, oder du musst dir deine Wurscht lang einteilen!“
Die Kokarde hatte wie erwartet entsprechend gewirkt. Der Mann wurde von einem Augenblick zum nächsten gleich viel umgänglicher. „Aber warum sagen S’ das denn ned gleich, Herr Inspektor? Man hilft ja gern. Gleich um die Ecke warat’s. Schalter 5. Is ned zum Verfehlen.“
„Danke“, knurrte Bronstein und wandte sich ab. Er umkurvte eine Säule und stellte sich dann beim genannten Schalter an. Die Dame vor ihm schien mit der neuen Technik noch nicht so recht vertraut zu sein, denn sie redete auf den Apparat ein, ohne überhaupt angeläutet zu haben.
„Verzeihung, Gnädigste, aber ich nehme an, Sie wollen telefonieren?“, meldete sich Bronstein sachte zu Wort. Die alte Frau drehte sich zu ihm um: „Na, was glauben S’, warum i da steh?“
„Ja, ja, das habe ich ja vermutet. Allerdings müssten Sie in diesem Fall zuerst den Hörer abheben und dann anläuten.“
„Hörer? Anläuten? Wollen S’ mi pflanzen?“
„Ganz und gar nicht, Gnädigste. Doch das Fräulein vom Amt kann Sie natürlich nur verbinden, wenn Sie sich zuerst einmal bemerkbar machen.“
„A so?“ Die Frau schien nun wirklich erstaunt zu sein.
Bronstein trat einen Schritt vor. „Sie gestatten?“ Dann nahm er den Hörer aus seiner Halterung. „So, den müssen S’ jetzt an Ihr Ohr halten. Und ich läut derweilen für Sie an.“
Tatsächlich meldete sich wie erwartet die Bedienstete der Vermittlung. Die alte Dame strahlte. „Jetzt müssen S’ sagen, wen Sie sprechen wollen“, flüsterte Bronstein.
„Den Ferdinand“, sagte sie glückselig.
„Was heißt da welchen? Na meinen natürlich.“ Über den Apparat hinweg sah die Dame Bronstein an und schüttelte missbilligend den Kopf: „Nicht sehr helle, das junge Fräulein.“
„Aber ich bitte Sie, Gnädigste. Die Dame von der Vermittlung kann Sie ja nicht sehen. Sie müssen ihr daher schon sagen, wie der Ferdinand noch heißt.“
„Na so wie i. Er ist ja mein Bub.“
„Aha“, sagte Bronstein gottergeben. „Und wie heißen nachher Sie?“
„Sie Schlingel!“, lächelte die Alte nun anzüglich. „Da kennen wir uns gerade fünf Minuten, und schon wollen S’ wissen, wie ich heiß! Wenn des mein Verewigter sehen tät, der tät schön schauen.“
„Wissen S’ was, gnä’ Frau. Da am Schalter 4 können S’ die ganze Angelegenheit persönlich erledigen. Das ist vielleicht besser.“
Jetzt zog sie ein Schnoferl, als wäre sie noch ein jugendlicher Backfisch. „Na, wenn S’ meinen.“ Enttäuscht räumte die Frau das Feld und suchte den Schalter 4, auf dem immer noch in Balkenlettern „Telegramme“ stand.